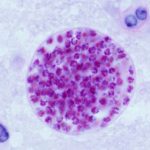Hamed Abdel-Samad spricht mit ALIAS über Rassismus, Opferrollen und die Gemeinsamkeiten zwischen unaufrichtigen Israel-Kritikern und Gangster-Rappern.
Hamed Abdel-Samad wuchs in Ägypten als Sohn eines Imams auf. Als Student noch Anhänger der Muslimbruderschaft ist der heute in Deutschland lebende Politikwissenschaftler später, wie er sagt, „vom Glauben zum Wissen konvertiert“. Aufgrund seiner islamkritischen Schriften wurde 2013 eine Fatwa gegen ihn verhängt, seither lebt er unter Polizeischutz.
In seinem neuen Buch „Schlacht der Identitäten“ denkt Abdel-Samad darüber nach, wie wir dem Rassismus seine Macht nehmen.
ALIAS: Herr Abdel-Samad, wer Rassismus bekämpfen will, so verstehe ich die Stoßrichtung von „Schlacht der Identitäten“, der sollte dieses Thema nicht als Schuldfrage behandeln. Ein schöner Satz aus Ihrem Buch lautet: „Erst wenn man seine eigenen Gefängnisse begreift, lernt man, die anderen nicht dafür zu verfluchen, dass auch sie in einem Gefängnis sitzen.“
Hamed Abdel-Samad: Ich glaube, dass Rassismus eine anthropologische Konstante ist – es gibt ihn in allen Gesellschaften. Und als Teil der Gesellschaft sitzt jeder Mensch in seinem eigenen Kerker. Manche Gruppen machen keinen Hehl aus ihrem Rassismus, bei anderen existiert er versteckt oder schlafend. Das Problem ist: Wer nach Rassismus sucht, wird ihn überall finden – und wenn er ihn erst wecken muss, um ihn zu diagnostizieren.

ALIAS: Was meinen Sie damit genau?
Abdel-Samad: Einige Debatten führen nicht dazu, tatsächlichen Rassismus zurückzudrängen, sondern erwecken ihn erst. Das passiert, wenn man den Kreis derer, die als Rassisten gelten, immer weiter fasst. Dann gilt zum Beispiel jeder als Rassist, der den Islam kritisiert, der Gender-Sprachregelungen ablehnt oder ganz allgemein politische Korrektheit in der Gesellschaft anprangert. Aber man muss sich nicht mal mehr äußern, neuerdings ist man mitunter schon Rassist, wenn man keine sogenannte „Person of Color“ zu seinen Freunden zählt. Was wollen wir damit erreichen? Sollte nicht jeder seinen Freundeskreis selbst bestimmen dürfen? Wenn ich Menschen ständig schuldig spreche, reduziere ich sie auf ihre Schwächen. Dabei sollten wir doch das Beste und Stärkste in den Menschen suchen. Jemanden auf seine Schwächen zu reduzieren, erzeugt Angst und zielt auf den Gehorsam der Person ab, deren Einstellung beanstandet wird. Wer sich vor Verunglimpfungen schützen möchte, verfällt dann in sogenannten „Double Talk“. Man wird gezwungen, sich in der Öffentlichkeit anders zu äußern, als man es im eigenen Freundeskreis tut. Ich halte so ein Leben für menschenunwürdig.
ALIAS: Der Hang zur Schuldigsprechung soll vermutlich jeden Ansatz von Rassismus bereits im Keim ersticken.
Abdel-Samad: Diese Haltung hilft aber den echten Opfern von Rassismus nicht. Die meisten Menschen, die sich gerade auf der Bühne des Antirassismus profilieren, sind entweder privilegierte Linke oder privilegierte Migrantenkinder, die aufgrund ihrer Herkunft zum Beispiel Jobs als Journalisten bekommen haben – auch dann, wenn sie nicht besonders gut schreiben können. Lustigerweise wollen gerade jene Menschen, die ihre Karriere ihrer Herkunft verdanken, nicht auf ihre Herkunft reduziert werden. Sie beantragen zwar Fördergelder aufgrund ihres Status als Kinder von Migranten, wollen aber nicht gefragt werden, woher sie kommen. Mich erinnert das an den Moslem, der es zwar ablehnt, dass in der Schule seines Kindes ein Weihnachtsbaum steht, aber kein Problem damit hat, Weihnachtsgeld zu kassieren. Ich denke, es geht um Intentionen: Was will ich erreichen, wenn ich auf den Schuldeiterbeutel der Deutschen drücke? Vielleicht steckt nur der Wunsch dahinter, die eigene Machtposition auszubauen? Es sind ja längst nicht mehr nur Linke oder junge Akademiker mit Migrationshintergrund, die Fördergelder für antirassistische Projekte beantragen, sondern auch islamistische Vereine. Der Rassismus-Begriff muss dann für Menschen herhalten, die den türkischen Staatspräsidenten Erdoğan kritisieren.
Manche beantragen zwar Fördergelder aufgrund ihres Status als Kinder von Migranten, wollen aber nicht gefragt werden, woher sie kommen.
Hamed Abdel-Samad
ALIAS: SETA, eine Denkfabrik, die der türkischen Regierungspartei AKP nahesteht, hat eine Liste von Islamkritikern erstellt, auf der auch Sie gelandet sind.
Abdel-Samad: Sowie die Ethnologin Susanne Schröter, der Psychologe Ahmad Mansour, die Frauenrechtlerin Seyran Ateş und viele andere. Dieser Liste liegt eine Studie von Farid Hafez zugrunde, die von der EU unter dem Titel „Islamophobie-Report“ veröffentlicht wurde und als Maßstab für Europa gelten soll. Das ist gefährlich, weil es Islamisten ermöglicht, im Schatten des vermeintlichen Kampfs gegen Rassismus Gelder zu kassieren und so über Fördermittel der EU auch hierzulande ihre Infrastruktur aufzubauen.
ALIAS: Und es erweitert den Kreis der potenziellen Rassismus-Opfer drastisch, oder?
Abdel-Samad: Gerade jüngeren Migranten wird es so schwer gemacht, sich von alten Strukturen zu emanzipieren. Identitätspolitik ist antiaufklärerisch. Es findet gerade eine ganze Reihe von Konterrevolutionen gegen die Aufklärung statt. Dazu gehört der waschechte Rassismus, weil er Menschen nicht als Individuen sieht. Etwas sehr Ähnliches verfolgen aber auch der religiöse Fundamentalismus und die Identitätspolitik vieler Linker: Sie teilen Menschen in vermeintlich homogene Gruppen auf, die entweder Täter oder Opfer sind. Der Anspruch auf Deutungshoheit des modernen Antirassismus hat religiöse Züge. Genauso wie die Neigung, stets auf die Schuld im Menschen zu sprechen zu kommen und die Gesellschaft umerziehen zu wollen. Parallelen sehe ich außerdem in der Haltung gegenüber der Freiheit. Identitätspolitik beschäftigt sich stärker mit dem Aufstellen von Dogmen und der Gleichschaltung von Personen als mit den Wünschen des Individuums.
ALIAS: Und es gibt eine Erbsünde …
Abdel-Samad: Genau, der weiße Mann ist in der identitätspolitischen Erzählung genetisch determiniert, rassistisch zu handeln, denn er wird als Rassist geboren. Das ist keine humanistische, sondern eine sehr ideologische Haltung. Ich erkenne diese Parallelen leichter als andere in Deutschland, weil ich aus einer islamistischen Gesellschaft stamme. Aber auch viele, die in der DDR aufgewachsen sind, fühlen sich angesichts des modernen Antirassismus an etwas erinnert: die Art, wie die SED mit Gedanken und Sprache umgegangen ist.
ALIAS: Identitätspolitik schaut auf das Kollektiv statt auf das Individuum. In Ihrem Buch berichten Sie von einer Situation aus Ihrem Leben, in der sie sich, obwohl Sie rassistisch angegriffen wurden, entschieden, ihren Kontrahenten als Individuum zu betrachten und nicht in Gruppen-Schuldzuweisungen zu verfallen.
Abdel-Samad: Ich saß in einer Münchener S-Bahn, als ein Fußballfan durch die Tür polterte und mich anbrüllte: „Scheiß Ausländer! Warum gehst du nicht nach Hause?“ Es bedarf einiger Anstrengung, um als Mensch vom Reflex auf die Reflexion umzustellen – meine erste Reaktion war deshalb Angst. Für mich wurde in diesem Moment meine Existenz in Deutschland infrage gestellt. Die Beleidigung „Scheiß Ausländer“ erzeugte in meinem Kopf sofort den Gedanken „Scheiß Deutscher“.
ALIAS: Eine Verallgemeinerung auf beiden Seiten.
Abdel-Samad: Aus Angst wurde Wut. Ich wollte der Situation entkommen und log deshalb – der Mann, der mich beschimpft hatte, trug einen Schal des Fußballvereins 1860 München, und ich behauptete einfach, dass ich auch ein 60er-Fan sei. Die Reaktion des Mannes brachte mich zum Nachdenken: Er lächelte, fragte mich, ob man in meinem Land wirklich die „Sechzger“ kenne und setzte sich zu mir. Wäre er ein echter Rassist voller Hass gewesen, hätte es für ihn keine Rolle gespielt, welchen Fußballverein ich anfeuere. Ich merkte, dass mein gegenüber nach irgendeiner Gemeinsamkeit mit jemandem suchte. Vielleicht hatte er nur „Scheiß Ausländer!“ geschrien, weil er etwas nachäffte, was er bei anderen gesehen hatte – ein gruppendynamisches Phänomen, das ihm für kurze Zeit ein Gefühl von Macht verlieh. Das ist typisch für schwache Menschen. Sie verhalten sich wie Gangster-Rapper, die sich nur aufwerten können, indem sie andere abwerten. Selbst in Beziehungen spielt so etwas eine Rolle. Man kämpft mit eigenen Unsicherheiten, will nicht zugeben, dass man schwach ist und macht deshalb seinen Partner oder seine Partnerin nieder. Aggression als Abwehrstrategie.
Es bedarf einiger Anstrengung, um als Mensch vom Reflex auf die Reflexion umzustellen.
Hamed Abdel-Samad
ALIAS: Darin liegt für Sie der Kern des Rassismus?
Abdel-Samad: Für mich entsteht Rassismus nicht aus Überlegenheitsgefühlen, sondern wird aus existenzieller Angst und Unsicherheit geboren. Schon Homos Sapiens und Neandertaler konnten sich nicht besonders gut ausstehen – und dafür gab es echte Gründe. Es ging um Verteilungskämpfe. Später kamen die Religionen ins Spiel.
ALIAS: Religionen haben Rassismus geschürt?
Abdel-Samad: Nicht immer. Als sie noch polytheistisch waren, also mehrere Götter angebetet wurden, gab es keine Religionskriege. Erst mit der Idee des einen Gottes ergab sich die Motivation, sich von anderen Gläubigen abzugrenzen. Dieser Gedanke findet sich heute in vielen säkularen Ideologien wieder. Der Faschismus ist die Wiedergeburt des abrahamitischen Faschismus. Ich weiß, das klingt heftig und macht auch viele Freunde von mir wütend, aber ich sehe es so.
ALIAS: Das müssen sie konkretisieren. Was verleiht den Religionen von Juden, Christen und Moslems faschistische Züge?
Abdel-Samad: Der Legende nach erhielt Abraham von Gott den Befehl, seinen Sohn Isaak umzubringen. Und was tat Abraham? Er zögerte nicht, seinen Sohn zu opfern. Das ist die Grundidee des Faschismus: Befehle werden nicht unter humanistischen Maßstäben abgewogen, sondern als Gesetze behandelt, die von einem Führer erlassen und deshalb bedingungslos befolgt werden müssen. Der Führer zählt mehr als die eigene Familie. Die Grundidee monotheistischer Religionen und faschistischer Ideologien lautet: Wer nicht mit uns ist, der ist gegen uns.
ALIAS: Woher rührt diese Feindseligkeit?
Abdel-Samad: Weil der Monotheismus behauptet, die absolute Wahrheit zu kennen, interpretiert er Andersdenkende als Bedrohung. Sowohl in der anthropologisch vorgegebenen Feindseligkeit gegenüber Fremden, die den Menschen seit Urzeiten begleitet, wie auch in den Religionen und den säkularen Ideologien ist es die Unsicherheit, die sich als Überlegenheitsgefühl tarnt.
ALIAS: Sie nennen noch eine andere Form des Rassismus – die Schuldabwehr.
Abdel-Samad: In meinem Buch gebe ich dafür das Beispiel der Japaner, die im Zweiten Weltkrieg zahlreiche Massaker an Chinesen und Koreanern begangen haben. Angehörige dieser beiden Völker werden in Japan viel stärker unterdrückt als andere Minderheiten – weil man die eigene Schuld nicht zugeben möchte. Ich glaube auch, dass eine bestimmte aggressive Form des Antisemitismus in Deutschland auf dieses Phänomen zurückzuführen ist. Es wird versucht, das eigene Opfer zu verteufeln, um irgendwie quitt zu sein.
ALIAS: Dieser Antisemitismus tritt dann häufig als „Israel-Kritik“ auf.
Abdel-Samad: Dazu hat der österreichisch-israelische Arzt Zvi Rex einmal gesagt „Die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen.“ Israel heißt es, wiederhole auch nur das, was die Nazis gemacht haben. Und wenn das so ist, können die Deutschen sich beruhigen: Sie befinden sich mit ihrem Opfer wieder auf einer Ebene. Eine klassische Schuldabwehr.
Mir ist wichtig, dass Opfer von Rassismus nicht ermutigt werden, in ihrer Opferrolle zu verharren.
Hamed Abdel-Samad
ALIAS: Ich würde gern noch einmal auf den Vorfall in der Münchener S-Bahn zurückkommen, den Sie in Ihrem Buch beschreiben. Sie konnten sich in dem Moment entscheiden, wie sie reagieren?
Abdel-Samad: Ja, aber meine Unsicherheit, die ich als Opfer eines rassistischen Angriffs empfand, hatte Einfluss darauf, wie ich die Situation bewertete. Ich kam aus Ägypten und war vollgepumpt mit Vorurteilen über Deutsche. Mein Vater hielt die Deutschen für kaltblütig und arrogant. Er sagte, dass dieses Land mich weder brauchte noch wollte. Die einzigen Bilder aus dem modernen Deutschland, die meine Mutter kannte, waren marschierende Neonazis. Und nun geriet ich in diese Situation mit dem Fußballfan und dachte: Was ist mit meinen Vorurteilen über Deutsche? Die Unsicherheit des Mannes kreuzte sich mit meiner. Der Gekränkte in ihm fand den Gekränkten in mir. Ich musste mich entscheiden: Gehe ich nach Hause und heule, weil ich rassistisch angegriffen wurde, oder denke ich darüber nach, was mit mir los ist? Ich wusste, dass ich diesem Menschen vermutlich nie wieder in meinem Leben begegnen würde, warum sollte ich ihn also überhöhen? Gerade so, als hätte der Bundeskanzler höchstpersönlich mich beleidigt. Gab es wirklich einen Grund, sich existenziell bedroht zu fühlen? Mir ist wichtig, dass Opfer von Rassismus nicht ermutigt werden, in ihrer Opferrolle zu verharren. Nein, es ist viel sinnvoller, ihr Selbstwertgefühl zu stärken, indem man ihnen beibringt, sich nicht über Fremdzuschreibungen zu definieren.
ALIAS: Dazu erzählen Sie in „Schlacht der Identitäten“ eine schöne Geschichte des puerto-ricanischen Schriftstellers Jesús Colón.
Abdel-Samad: In den Fünfzigerjahren saß Colón in einer New Yorker U-Bahn und sah, wie eine junge Frau mit zwei Kindern und zwei Koffern es kaum schaffte, in den Waggon zu kommen. Als die Frau an derselben Station, die auch Colóns war, ausstieg, wollte er ihr helfen, tat aber nichts. Er hatte Angst, dass sie wegen seiner Hautfarbe befürchten würde, von ihm überfallen zu werden. Als Colón nach Hause ging, wurde ihm klar, dass er gegen seine Menschlichkeit gehandelt hatte. Er ergab sich den Rassisten, die genau diese Rolle als aggressiver Schwarzer, der Frauen überfällt, von ihm erwarteten. Es ist gefährlich, sich mit solchen Fremdzuschreibungen zu identifizieren. Der Opferdiskurs, der aktuell von vielen Antirassisten geführt wird, schafft aber genau dafür beste Bedingungen, weil er Menschen auf ihre Gruppenzugehörigkeiten reduziert.
ALIAS: Sie begreifen Rassismus als Antagonismus. Eine Ansicht, die immer weniger Menschen zu teilen scheinen. Als Rassist gilt manchmal schon, wem Unterschiede zwischen ethnischen Gruppen auffallen. Was paradox ist, denn wenn sich eine Gruppe als solche identifizieren lässt, bedeutet das zwangsweise, dass sie Eigenschaften hat, die sich von den Eigenschaften anderer Gruppen unterscheiden.
Abdel-Samad: Es wird sehr viel mit Rassismus verwechselt. Solange man die positiven Eigenschaften einer Ethnie hervorhebt, bekommt man in der Regel kein Problem. Sagt man, die Araber seien gastfreundlich, gilt das nicht als Rassismus. Niemand wendet dann ein: „Es gibt solche und solche! Welche Araber meinst du?“ Es hilft uns als Gesellschaft nicht, immer sensibler dafür zu werden, Kränkungen zu identifizieren. Wir müssen uns entspannen.
ALIAS: Herr Abdel-Samad, vielen Dank für das Gespräch.
Hamed Abdel-Samads neues Buch „Schlacht der Identitäten. 20 Thesen zum Rassismus – und wie wir ihm die Macht nehmen“ ist bei dtv erschienen (144 S., 14 €).
Interview: Florian Friedman
Abonnieren Sie unseren Newsletter!
Ich möchte über Artikel und Aktivitäten von ALIAS auf dem Laufenden gehalten werden.